DEINE SPENDE KANN LEBEN RETTEN!
Mit Amnesty kannst du dort helfen, wo es am dringendsten nötig ist.
DEINE SPENDE WIRKT!
Bumerangeffekte
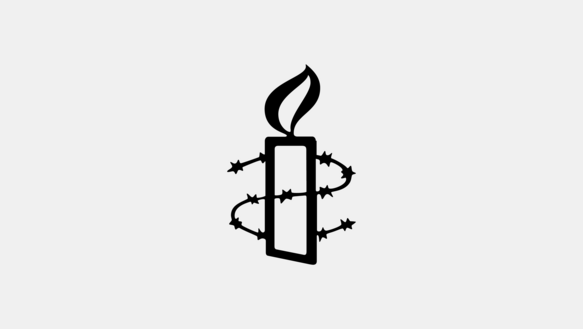
75 Jahre nach der Staatsgründung bleiben die Beziehungen zwischen palästinensischen und jüdischen Israelis schwer belastet – nicht zuletzt in den binationalen Städten des Landes.
Aus Lod Markus Bickel
Eine hohe Metallwand schirmt den Innenhof von Fida Shehadas Haus von der Straße ab, sanft schmiegt sich eine Katze an die breite Fensterfront gegenüber dem hohen Eingangstor. Die frühere Stadträtin von Lod hat zum Gespräch in das Haus ihrer Familie geladen, ihre Mutter serviert Makluba, das traditionelle palästinensische Reisgericht. Auf einem großen Flatscreen an der Wand hinter dem Esstisch sind Bilder von mehreren Überwachungskameras zu sehen.
Nicht ohne Grund. Denn auch zwei Jahre nach den tödlichen Ausschreitungen zwischen jüdischen und israelisch-palästinensischen Bewohner*innen im Mai 2021 gibt es immer wieder Spannungen in der 77.000-Einwohnerstadt, die knapp zwanzig Kilometer südöstlich von Tel Aviv liegt. Das Altstadtviertel Ramat Eshkol, in dem die Shehadas wohnen, ist einer der Brennpunkte, seit Angehörige der nationalreligiösen Garin Torani (Kern der Tora) in den frühen 2000er Jahren vermehrt nach Lod zogen, um die jüdische Präsenz zu stärken. Mit tausend Familien bildet die Garin-Torani-Gemeinschaft hier inzwischen die älteste und größte in Israel, eines ihrer Büros unterhalten sie schräg gegenüber vom Haus der Shehadas.
Rechte schüren Konflikte
Um Spannungen zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen abzubauen, kandidierte die 38-jährige Stadtplanerin 2018 für den Gemeinderat von Lod, einer der ärmsten binationalen Städte des Landes mit hoher Arbeitslosigkeit. Doch im November 2022, kurz nach der Knesset-Wahl, die die bisher rechteste Regierung in der Geschichte Israels an die Macht brachte, trat Shehada zurück. 15 Prozent der Stimmen holte hier die rechtsextreme Allianz Religiöser Zionismus, die offen für eine Annexion weiter Teile des besetzten Westjordanlands und die Umsiedlung der dortigen palästinensischen Bevölkerung eintritt.
Shehada sieht erschöpft aus, als sie sagt, dass sie mit ihrem Engagement ihrer Gemeinschaft nicht habe helfen können. Dafür macht sie vor allem Bürgermeister Yair Revivo von der nationalkonservativen Likud-Partei verantwortlich: "Ich hatte viele Pläne, um das Leben der arabischen Bewohner Lods zu verbessern, doch habe ich von ihm nie Unterstützung erfahren", sagt sie. Revivo sehe sich "nur als Bürgermeister der Juden".
Der Verdacht kommt nicht von ungefähr, schließlich macht Revivo keinen Hehl aus seiner Nähe zu rechten Gruppen. So begleitete er nur wenige Tage vor den gewaltsamen Ausschreitungen im Mai 2021 den rechtsextremen Vorsitzenden der Partei Jüdische Stärke und heutigen Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, durch Lod. "Jüdische Kriminelle haben einen Funken Mitgefühl", sagte er 2020 in einem Interview, arabische Kriminelle hätten hingegen "keine Hemmungen" – sie stellten eine "existenzielle Bedrohung für den Staat Israel" dar. Als im Jahr 2017 Gläubige am Abend des muslimischen Opferfests dem Aufruf des Muezzins in die Dahmash-Moschee der Stadt folgten, drang Revivo in das Gotteshaus ein, um die Lautsprecher abzuschalten, weil diese seiner Ansicht nach für die jüdische Nachbarschaft "tägliches Leid und Belästigung" darstellten.

"Epidemie krimineller Gewalt"
Der Vorfall sorgte damals für einen Sturm der Entrüstung, und die Klagen über Revivos einseitige Haltung reißen bis heute nicht ab. Shehada verweist darauf, dass im Stadtrat zwar sechs der 19 Abgeordneten arabischen Parteien angehörten, doch nur 14 Prozent der städtischen Angestellten seien israelische Palästinenser*innen – bei einem Bevölkerungsanteil von etwa 30 Prozent. Anders als in anderen binationalen Städten des Landes wie Haifa, Akko oder Ramle hat es in Lod außerdem seit mehr als vier Jahrzehnten keinen stellvertretenden palästinensischen Bürgermeister mehr gegeben.
Wie in einem Brennglas bündelten sich die drängendsten Probleme Israels in Lod, sagt auch der Kovorsitzende der Nichtregierungsorganisation Abraham Initiatives, Amnon Be’eri-Sulitzeanu. Er spricht von einer "Epidemie krimineller Gewalt", die das Leben in der Stadt lähme. Eine halbe Stunde dauert der Fußweg von Shehadas Haus in Ramat Eshkol bis zum Gewerbegebiet am nördlichen Stadtrand, wo sich die Organisation niedergelassen hat. Während die strahlend weiße griechisch-orthodoxe St.-Georgskirche und die frisch herausgeputzte Dahmash-Moschee im Stadtzentrum noch an bessere Tage Lods während osmanischer Herrschaft erinnern, verfliegt dieser Eindruck hier beim Gang über ungeteerte Wege, vorbei an Flachbauten mit Metalldächern und Müllhaufen.
Die Gründer der ersten israelischen NGO, die jüdisch-palästinensisches Zusammenleben ins Zentrum ihrer Arbeit rückt, hätten sich ganz bewusst für Lod als Sitz entschieden, sagt Be’eri-Sulitzeanu. Von den 9,5 Millionen Israelis gehören rund zwei Millionen der palästinensischen Minderheit an, 45 Prozent von ihnen leben in Armut, unter der jüdischen Bevölkerung sind es nur 13. Zwar kämpften andere binationale Gemeinden mit denselben Problemen wie Lod, sagt Be’eri-Sulitzeanu. Doch nirgendwo liege die Peripherie so nah am Zentrum wie in der von Staat und Wirtschaft vernachlässigten Trabantenstadt unweit des Ben-Gurion-Flughafens.

Wie dünn das jüdisch-palästinensische Band ist, das durch immer neue Konflikte seit Jahrzehnten auf eine harte Probe gestellt ist, hätten die Ausschreitungen in Israels binationalen Städten im Mai 2021 überdeutlich gemacht, sagt der jüdische der beiden Kovorsitzenden der Abraham Initiatives. Und sie hätten gezeigt, wie kurz der Schritt von vordergründig freundschaftlichen nachbarlichen Beziehungen hin zu einem möglichen Bürgerkrieg ist. Auf Seiten der israelischen Palästinenser*innen komme das Gefühl hinzu, als Bürger*innen zweiter Klasse behandelt zu werden. Die Verabschiedung des sogenannten Nationalstaatsgesetzes 2018 etwa sorgte dafür, dass Arabisch als Amtssprache abgeschafft wurde.
Um den Niedergang der jüdisch-palästinensischen Beziehungen zu erklären, geht Be’eri-Sulitzeanu aber noch weiter zurück – und macht die politischen Versäumnisse nach Abschluss der Oslo-Verträge in den 1990er Jahren für die anhaltenden Spannungen verantwortlich. Es sei eine Illusion gewesen, zu glauben, dass sich die Konflikte zwischen jüdischen und palästinensischen Israelis von selbst lösen würden, sozusagen als Nebeneffekt einer damals noch in Reichweite liegenden Zweistaatenlösung. Eine "riesige Koexistenzindustrie" sei in diesen Jahren entstanden, sagt Be’eri-Sulitzeanu, mit Tausenden Projekten, die Jüdinnen und Juden sowie Palästinenser*innen bei Begegnungen zusammenbringen sollten. Doch als im Oktober 2000, kurz nach Beginn der Zweiten Intifada, 13 israelische Palästinenser, die gegen den Militäreinsatz im Westjordanland demonstrierten, von der israelischen Polizei erschossen wurden, brach dieser Ansatz in sich zusammen.

"Never surrender": Proteste gegen die sogenannte Justizreform in Rechovot (Israel, 18.03.2023)
© Amir Goldstein / Anadolu Agency / pa
Viel zu lange hätten sich zentristische, aber auch linke Parteien wie Meretz und Avoda vorgemacht, die Bumerangeffekte der völkerrechtswidrigen Besatzung des Westjordanlands auf das israelische Kernland ignorieren zu können, glaubt Be’eri-Sulitzeanu. Dabei gab es schon seit Langem Warnsignale: Das Nationalstaatsgesetz von 2018 etwa definierte Israel als "Nationalstaat des jüdischen Volks"; nach den interkonfessionellen Ausschreitungen im Mai 2021 wurden vor allem israelisch-palästinensische Gewalttäter zur Rechenschaft gezogen, kaum jüdische.
Armutsbekämpfung und Bildung
Für Be’eri-Sulitzeanu ist der Ausweg aus der Krise klar: "Wir müssen Gleichheit als Ziel fördern, nicht Koexistenz", sagt er. Ein Dialog auf Augenhöhe sei schließlich erst dann möglich, wenn beide Bevölkerungsgruppen über gleiche Rechte verfügten, was angesichts der Lücken im Bildungssystem, dem schlechteren Zugang von Palästinenser*innen zu Arbeitsmarkt und Verwaltung zurzeit nicht gegeben sei. Die Abraham Initiatives hätten das früh erkannt und ihr Konzept nach Beginn der Zweiten Intifada deshalb radikal umgestellt. Armutsbekämpfung, Bildungsprojekte und politisches Lobbying in Kabinett wie Knesset haben den ursprünglichen Ansatz, über persönliche Begegnungen eine politische Lösung herbeizuführen, ersetzt.
Be’eri-Sulitzeanu wird nicht müde zu erzählen, wie von seiner NGO entwickelte Projekte inzwischen in Staatshand übergegangen seien, darunter in einigen Vorzeigeschulen auch Arabischunterricht für jüdische Schülerinnen und Schüler. Zugleich macht er sich keine Illusionen darüber, dass das, was Lod vor zwei Jahren erlebte, nur ein Vorbote für ähnliche Verwerfungen in anderen israelischen Gemeinden sein könnte. Fünf Tage lang brannten hier im Mai 2021 Autos, Häuser und Synagogen, ein muslimischer Friedhof wurde verwüstet, und zum ersten Mal seit 1966 rief die Regierung wieder den Notstand in einer israelischen Gemeinde aus. Zwei Jahre später sind die Spuren der Ausschreitungen auch im Altstadtviertel Ramat Eshkol noch nicht überall beseitigt, und für zerstörte Wohnungen wurden keine Entschädigungen gezahlt.
Bei den in Israel als "Mai-Ereignisse" bezeichneten Unruhen kamen zwei Bewohner Lods ums Leben. Doch wurden die Verantwortlichen für den Tod des Palästinensers Musa Hassuna nicht gefasst, während für den Mord an Yigal Yehoshua acht palästinensische Männer angeklagt wurden. Jene weitgehende Straflosigkeit, die die Soldaten der Israeli Defence Forces (IDF) in den besetzten Gebieten genießen, sorge nicht nur im Westjordanland für ungleiche Verhältnisse, sondern zunehmend auch im israelischen Kernland, fürchtet Be’eri-Sulitzeanu.
Kurz vor dem 75. Jahrestag der israelischen Staatsgründung im Mai 1948 verheißt das nichts Gutes. Zehntausende palästinensische Bewohner*innen der Stadt wurden in den Wochen danach von jüdischen Milizen aus Lod vertrieben, mehr als 300 getötet, Dutzende von ihnen in der wieder hergerichteten Dahmash-Moschee im Zentrum der Stadt. An jenem Ort also, zu dem sich Bürgermeister Revivo vor einigen Jahren wegen vermeintlicher Lärmbelästigung durch den Gebetsruf des Muezzins Zugang verschafft hatte.
Markus Bickel ist freier Journalist und Autor. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung von Amnesty International wieder.
HINTERGRUND
von Markus Bickel
Fast hundert Tage dauerten die Proteste, ehe Benjamin Netanjahu Ende März einlenkte: Die Beratungen in der Knesset über die umstrittene Justizreform seiner rechtsreligiösen Regierung würden erst nach den Pessach-Feierlichkeiten Mitte April wieder aufgenommen, kündigte Israels Ministerpräsident an. Seitdem beraten Angehörige der parlamentarischen Opposition um Netanjahus Vorgänger Jair Lapid und den früheren Verteidigungsminister Benny Gantz über mögliche Kompromisse.
Ziel des Kabinetts, dem neben Ministern aus Netanjahus nationalkonservativem Likud auch Vertreter der rechtsextremen Partei Jüdische Stärke und der ultrareligiösen Schas-Partei angehören, ist es unter anderem, die Kompetenzen des Obersten Gerichts zu beschneiden. Einerseits dadurch, dass der Regierung mehr Einfluss bei der Besetzung des Gremiums eingeräumt wird, andererseits dadurch, dass Entscheidungen der höchsten Richter*innen mit einfacher Parlamentsmehrheit in der Knesset überstimmt werden dürfen.
Gegen diese Pläne protestieren nicht nur die Zivilgesellschaft seit Januar, sondern auch die einflussreichen Angehörigen des israelischen Hightech-Sektors sowie Reservist*innen der Armee. Der von Netanjahu Ende März entlassene und mittlerweile wieder eingesetzte Verteidigungsminister Yoav Galant hatte kurz zuvor gewarnt, dass eine Umsetzung der umstrittenen Justizreform die Moral des Militärs beeinträchtige und Israels Feinde in der Region ermutige. Angehörige der Protestbewegung kündigten an, ihre wöchentlichen Demonstrationen so lange fortzusetzen, bis die Regierung ihre Pläne zurückziehe.









